|
|

|
|
|

|
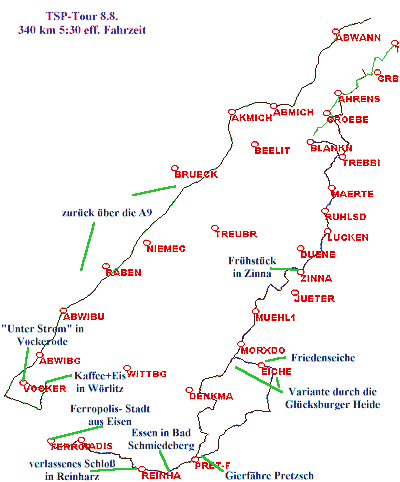
|
Was unterscheidet ein beliebiges Kaufhaus vom Tagebau-Museumspark "Ferropolis" Überhaupt hatte es den Anschein, als habe jemand die Uhren um gut zehn Jahre zurückgestellt - obwohl, mit knapp 30 Leuten in ein Resto einzufallen, ist schon mutig. In dem einen reagierte man denn auch empört, als so viele Kunden plötzlich mit Umsatz drohten. Bei der indisch-international angehauchten Ersatz-Futterkrippe dauerte es schließlich knapp zwei Stunden, bis alle versorgt waren, auf Tischtücher hatte man vorsichtshalber verzichtet, die wären auch schnell abgenagt gewesen...
Wer jetzt denkt, den Ausflug hätte man sich auch verkneifen können, teilt diese Auffassung mit der Majorität der Mitfahrer. Die waren am Abend nach einem Besuch am Wörlitzer Park zurück nach Berlin gedüst. Dass wir hier doch mehr zu schreiben haben, liegt an der Ausdauer und der Überredungskunst von Peter, der diese Tour organisiert hatte und bis zu diesem Punkt selbst recht sauer war über die Geschlossenheit der Ferropole (oder heißt es "Ferropode"?). Mit dem in jeder Gruppe unvermeidbaren Häuflein Unbeirrbarer im Schlepp zog ihn ein Schild an, das die Aufschrift trug: "Unter Strom". Was er dann darüber erzählte, war dem Autor Anlass genug, am Dienstag hinzuflitzen, damit der geneigte Leser von hier an für die bislang erduldete Qual dieses Einstiegs nun endlich belohnt werden kann.
Generell betrachtet, funktioniert die Stromerzeugung in Kraftwerken so: Eine Stelle macht viel heiße Luft und damit anderen Dampf. Die geraten mächtig unter Druck und fangen an zu rotieren. Dabei setzen sie ihre Energie frei, und alle dahinter stehen mächtig unter Spannung. Wer nun zum ersten Mal ein laufendes Kraftwerk besichtigt, ist geradezu erschüttert. Denn wenn die Turbinen-Generatoren-Sätze laufen, dann schwingt die Plattform, auf denen sie installiert sind, im Takt der zumeist 3000 Umdrehungen pro Minute (gleich 50 Hertz pro Sekunde, der Normfrequenz für Wechselstrom in Europa). Das kann ganz schön kribbeln, vor allem wenn man sich ausmalt, was geschieht, sollte auch nur ein kleines Teilchen versagen. In Kraftwerken kann das gefährlich werden. Nun sind die Stromerzeuger bis auf zwei Turbinenläufer leider alle entfernt worden, dennoch bekommt der Besucher viel zu sehen. Er muß gut zu Fuß sein, will er all die Schätze erschließen, die hier seit Juli ausgebreitet sind. Im vergangenen Jahr fand hier die Landesausstellung Sachsen-Anhalt mit vielen geschichtlichen Informationen statt, jetzt werden bis zum 24. Oktober vor allem die Themen Stromerzeugung und Chemie-Großtechnik in Mitteldeutschland behandelt. Zwölf mit Braunkohle befeuerte Kessel wurden in dem Kraftwerk betrieben, und in elf der Feuerräume sind nun die Ausstellungsthemen untergebracht. Zu Beginn dieses Rundgang-Teils wird man zunächst auf das höhlenartig Dämonische einer solchen "toten" Anlage eingestimmt. Der etwa fünf Meter im Quadrat messende Kesselraum zeigt noch mit Schlacke verkrustete Wände, an denen 184 Rohre installiert sind. In ihnen verwandelte sich das Wasser durch die Hitze zu Dampf. Orgelmusik von Liszt, Bach und Meyerbeer durchdringt das Halbdunkel, in dem nur eine Bank auf den Besucher wartet. Braunkohle wird oft als "nasse Blumenerde" verspottet, sie enthält bis zu 75 Prozent Wasser und einen Brennwert, der nur halb so groß ist wie der von Steinkohle. Andererseits istís besser als gar nix, Mitteldeutschland verfügt eben nicht über Steinkohleflöze. Wie die Kohle im Boden entsteht, und welche Beifunde sonst noch gemacht werden können, wird im zweiten Brennraum erklärt. Bernstein zum Beispiel, das sich aus Baumharz bildet, wurde in nennenswerten Mengen aus dem Bitterfelder Hauptflöz geholt, 1983 waren es über 49 Tonnen, lesen wir.
Aus diesem Grund ist übrigens das Kraftwerk Vockerode überhaupt erst entstanden. Es sollte vor allem das Buna-Werk in Schkopau (zwischen Halle und Merseburg, 60 Kilometer südlich von Vockerode) mit Strom versorgen, in dem der Synthetik-Kautschuk als Ersatz für Naturgummi produziert wurde. Als es 1940 in Betrieb ging, gab es allerdings nur sechs Dampferzeuger und Turbinen-Generatoren-Sätze für insgesamt 210 Megawatt elektrischer Leistung (zum Vergleich: Berlins größtes Kraftwerk, Reuter-West, bringt es auf knapp 600 Megawatt elektrisch). Die Braunkohle dafür wurde aus der Umgebung geholt, aus Tschornewitz, dann aus Golpa-Nord, Rösa, Gröbern und Delitzsch. Den Weg der Kohle kann man heute noch nachvollziehen, sofern man genug Puste hat, denn der Weg ist teilweise beschwerlich. Auf den Waggons erreichte sie zunächst den Kohlebunker, wurde auf Endlosbändern zu einer Brecheranlage transportiert und zu Staub zermahlen. Von dort aus gingís per Gebläse in die Kessel. Der dabei entstehende Dampf wurde in die parallel daneben liegende Maschinenhalle geführt und zu Strom umgesetzt. Mit dem Neuaufbau 1954 wuchs die Halle auf eine Länge von rund 300 Meter, denn die Anlage wurde vergrößert. Schließlich war ohnehin bei Kriegsende so gut wie alles, was noch brauchbar war, demontiert worden. Die Russen hatten ja im Krieg unter allen Alliierten am stärksten gelitten, weite Teile ihres Landes waren zerstört. Und so hielten sie sich an ihrem Einflussgebiet schadlos, zunächst mit Demontage-Reparationen. Dabei wurde freilich viel ohne Sinn für Technik aus den Wänden gerissen, zahllose Maschinen vergammelten überdies auf dem Transport nach Osten, so dass der Effekt wohl eher dürftig ausfiel.
Immerhin war die Anlage so konstruiert, dass die Kessel den Dampf zu einer Sammelleitung geführt wurde. Fiel ein Dampferzeuger aus, konnten alle Turbinen von den restlichen Kesseln gefüttert werden - gab eine Turbine auf, wurde der Dampf auf die anderen verteilt. Das ist auch für Inspektionen praktisch, man braucht nicht alles abzuschalten. Die Staubfeuerung wirkte sich positiv aus, weil sie weitgehend unabhängig von der Beschaffenheit der Kohle ist, ob Brocken oder Körnchen, es muß vorher doch alles durch die Mühle. Allerdings war der Wassergehalt im Winter, bei Frost, problematisch. Da mußten bisweilen schon umgebaute Flugzeugtriebwerke zum Abtauen eingesetzt werden, weil die Kohle oft in den Waggons fest fror.
Eine dritte Störung der Kohleversorgung geht auf das Konto eines Weihnachtsbaums. So hatte ein Lokführer kurz gestoppt, um sich einen solchen im Wald zu besorgen. Auf dem Rückweg in der Dämmerung fand er seinen Zug nicht mehr... Erst drei Stunden später erreichte er das Werk, da war der herrenlose Zug schon von den besorgten Kollegen gefunden und zurückgefahren worden. So steht's auf
Die Tour im Detail: |