|
|

|
|
|

|
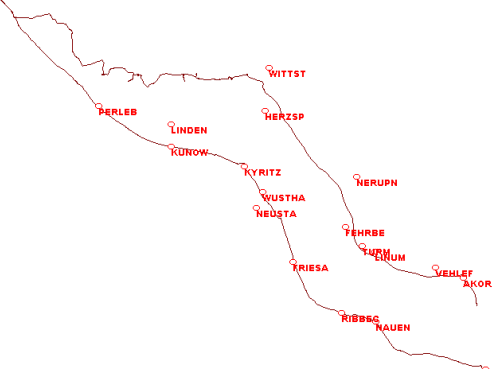
|
Eigentlich kann man das Wetter ja nur unter Wasser genießen - freilich sollte dabei die Nase noch herausragen. Aber auch auf dem Motorrad ist es auszuhalten, herausragend müssen dann eben die Ziele sein - denn Hochnäsigkeit zahlt sich auf dem Mopped nicht aus. Uns zog es am vergangenen Sonntag nach Ludwigslust in Meck ohne Pomm. Auf dem Weg dahin galt es überdies, Vergrabenes aufzutun. In Heiligengrabe und bei Seddin hatten wir Gelegenheit dazu. Wer aus Zeitgründen die Anfahrt über Land scheut, dem sei die Autobahn Richtung Hamburg empfohlen. Gleich hinter dem Kreuz Wittstock gehtís in Richtung Pritzwalk auf die Landstraße hinunter, da beginnt auch schon Heiligengrabe. Aber Vorsicht, die kurz zuvor abzweigende Autobahn nach Rostock trägt die Nummer 19 und die gewünschte Ausfahrt auch, und dieser Hinweis ist nützlich für all jene, die der Gruppe ";mal ein bißchen schneller vorausfahren"; wollen. Heiligengrabe war einst der berühmteste Wallfahrtsort der Prignitz. Die Klosteranlage der Zisterzienserinnen ist noch fast vollständig erhalten. So jedenfalls stand es im Brandenburg-Band ";Reise in die Geschichte - Schauplätze der Vergangenheit"; aus dem Kartografischen Verlag Busche, der uns bei unserer Zielsuche für die Umlandtouren schon manchen guten Dienst erwies. Und auch diesmal warís ein Treffer. Das Kloster ist unter Liebhabern etwa von Chormusik auch heute recht bekannt, so fahren auch einige starke Berliner Stimmen gleich gruppenweise hierhin. Die Anlage selbst ist eher zurückhaltend gebaut, im Vorbeifahren hätte man sie leicht mit einem simplen Gutshof verwechseln können. Auch die Heiligengrabkapelle - der spätgotische Backsteinbau wurde 1512 geweiht - ist vergleichsweise klein, allerdings mit Staffelgiebeln geschmückt. Das Fundament des Baus ruht auf einem anderen aus dem 13. Jahrhundert und letztlich ausgerechnet auf einem Schindanger, auf einer Hinrichtungsstätte. Ein Ort blutigen Ursprungs, und diese Tendenz setzte sich fort, allerdings weihevoll, versteht sich. Überliefert wird dies von einem interessanten mittelalterlichen Action-Krimi. Im benachbarten Techow jedenfalls, das an einer früheren Heer- und Handelsstraße von Wittenberge zur Oder liegt, soll ein Jude in die Kirche eingebrochen sein, Hostien entwendet und sie an jenem Richtplatz eingegraben haben. Nur habe die Hostie geblutet, das Blut den Dieb gekennzeichnet, er wurde ergriffen und hingerichtet. Crime pays, zwar nicht immer für den angeblichen Täter, aber dessen Schicksal verblaßt natürlich vor dem Aufschwung, den das ";Blutwunder"; der Stadt bescherte. Wallfahrtsort, das war damals schon was. Schließlich wurden hier fortan reiche Opfergelder gespendet. Blutig gingís auch weiter zu, als Markgraf Otto V. die inzwischen geheiligte Stätte besuchte. Da soll sich das Festessen in Blut verwandelt, und eine Stimme soll ihm im Traum den Vorschlag unterbreitet haben, dort doch ein Nonnenkloster zu stiften. Daß freilich nicht alles allein durch die blutrote Brille zu sehen ist, erfahren wir in einer Broschüre des Klosters: ";Doch muß die Gründung auf markgräflichem Boden der Prignitz auch einen strategischen Zweck gehabt haben. Es fällt eben auf, daß die Grenze der Mark zu Mecklenburg mit Frauenklöstern besetzt war (...). Sie dienten dem Aufbau und der Festigung von Territorialherrschaften."; Mithin eine frühe ideologische Verknüpfung von Blut und Boden, und alles vor dem Hintergrund, daß das einzige Menschenblut, das da wohl wirklich geflossen ist, das des Juden war. Nunja, daran, daß das Handeln von Herrschenden zynischer sein kann als das Denken des unverfrorensten Spötters, hat sich bis heute wohl kaum etwas geändert. Heute heißt das geldbringende Heiligtum ja seltener ";Hostie";, häufiger ";shareholder value";. Und wer es bedroht, wird nicht mehr verbrannt, sondern nur gefeuert. Der Fortschritt läßt sich eben nicht aufhalten.
Übrigens fand man bei Grabungen unter der Kapelle, als man dort eine Fußbodenheizung einbauen wollte, die Mauern eines kleinen Gewölbes. Opfer-Münzfunde deuten darauf hin, daß hier tatsächlich die Hostie bestattet worden war. Wie auch immer, nach so viel Blut war nun eher vegetarische Kost angesagt, eine Spezialität der Prignitz: Pizza in Pritzwalk, perfetto. Noch ein kurzer Spaziergang durch das Zentrum der Stadt, die im Zweiten Weltkrieg durch die Explosion eines (deutschen) Waffentransports schwer gelitten hat, dann stand schon das nächste kühle Grab auf dem Plan. Ungefähr 15 Kilometer westlich von Pritzwalk biegt von der B 189 eine Straße rechts nach Wolfshagen und nach Seddin ab. Nach knapp zehn holperigen Kilometern zweigt ein Feldweg ab, der zu einem weiteren interessanten archäologischen Fund führt. Hier war nämlich eine ganze Reihe von Grabhügeln entdeckt worden, die aus der jüngeren Bronzezeit stammen. Die rund 3000 Jahre alte Kammer des ";Königsgrabs"; soll sogar zu betreten sein. Doch als wir ankamen, war dummerweise niemand zu Haus, die Tür war verschlossen. Um den früheren Bewohner, Heinz oder Hinz (jedenfalls nicht Kunz) rankt sich ebenfalls ein Mythos. Es soll ein ";Riesenkönig"; gewesen sein, der hier in einem dreifachen Sarg bestattet worden war. 1899 öffnete man die Stätte und fand zunächst eine aus neun Steinplatten zusammengesetzte Kammer mit rot-weiß bemalten Lehmwänden (den ";Sarg"; Nummer 1). Darin stand ein etwa halbmeter hohes Tongefäß, in dem sich eine Bronzeurne befand. Also kann man auch einen ";Riesen"; kleinbekommen.
Darauf, daß es sich um eine höhergestellte Persönlichkeit gehandelt haben muß, deuten die Beigaben hin (die als originalgetreue Kopien im Kreisheimatmuseum Perleberg zu sehen sind). Der Ursprung dieser Arbeiten ist teilweise Süddeutschland, teils sogar den Ostalpen sowie nordischen Ländern zugeordnet worden - feinste Intershopware der Bronzezeit also, die nicht jedem zustand. Aber auch andere Grabhügel dieser Gegend zeugten von einer frühen Besiedlung - bis ein Unternehmer der Gründerzeit die Grundstücke der ahnungslosen Bauern kaufte und die dort abgelegten Steinbrocken als ";Steinbruch"; nutzte. Auch der Bannkreis aus Findlingsblöcken um das Königsgrab nahm diesen Weg. Es war eben nicht die Zeit, besonders empfindling zu sein. Schade nur, daß man an der im Wald versteckten und vom Weg aus nicht gekennzeichneten Stelle erstmal vorbeifährt. Dabei ist dieser Grabhügel immerhin elf Meter hoch und hat einen Durchmesser von 126 Metern. Um ihn aufzuhäufeln, müssen etwa 150 Menschen ein Jahr lang gebuddelt haben. Soviel Zeit nahmen wir uns nicht, denn wir wollen ja noch nach Ludwigslust, mal sehen, wo es einst so manchen Herzog hinzog. Am Nebenstraßen-Wegesrand wird uns en passant vorgeführt, wofür die Agronomen heute noch einen Trecker brauchen: zum Kirschenpflücken. Auf dessen Dach stehend kommt man eben viel besser auch an die hoch hängenden Früchte heran. Wald- und wiesenreich war es um Ludwigslust offenbar schon immer, und wenn die Herrschaften mal keine Kriege führten, gingen sie - eben gerade auch dort - auf die Jagd nach Wild. Herzog Christian Ludwig II. ließ sich daher von 1731 bis 1734 ein kleines Jagdschloß herrichten, dem Herzog Friedrich Franz 1754 den Namen ";Ludwigslust"; gab. Als dieser nun die Regierungsgeschäfte übernommen hatte, wurde Ludwigslust zur Residenzstadt ausgebaut. Schloß und Stadtkirche samt Bassin und Kaskaden entstanden, und da nichts vorhanden war, worauf man hätte Rücksicht nehmen müssen, konnte der Hofbaumeister Johann Joachim Busch einen großen Wurf landen. Die barocken und klassizistischen Gebäude zählen zu den wertvollsten Stadtanlagen des 18. und 19. Jahrhunderts, heißt es in der Stadtinformation. Der historische Stadtkern - vor allem auch die aufs Schloß zuführende Allee - ist denkmalgeschützt, sie wurde in den letzten Jahren weitgehend restauriert. Im Schloß war es bedeutend kühler als draußen, und so erwachte in Teilen der Gruppe das kulturelle Interesse. Naja, werís barock mag, kann hier die Möglichkeiten einer Einrichtungsform entdecken, die Elche allenfalls in Gestalt von Jagdtrophäen anerkennt. Und das soll damals schick gewesen sein? Bemerkenswert. Immerhin brauchte sich damals niemand mit dem Abrechner des Heizkostenverteilerdienstes herumzustreiten.
Seltsam fremd auch die Gesichter, die auf den Portraits der ausgestellten Sammlung zu sehen sind. Sehr große, hervorstehende Augen sind da zu sehen, sie sollen wohl gütig dreinblicken, schließlich wollte der jeweilige Maler ja wohl seinen Job nicht verlieren. Aber vielleicht wurden die Portraits auch mit dem Weitwinkelpinsel aufgenommen, das verzerrt die Proportionen doch bisweilen mächtig. Von so viel eigener Kulturfähigkeit ganz benommen, stießen wir auf den Rest der Gruppe, der es sich derweil im Café auf der Terrasse des Schlosses an Kuchen nicht hatte mangeln lassen. Dieser war schließlich viel jünger als die Einrichtung oben. Und zur Entschuldigung diente denn auch der Blick in den Schloßgarten, der immerhin eine Ausdehnung von rund 120 Hektar haben soll, was ihn zum ausgedehntesten Landschaftspark Mecklenburgs macht. Umfangreiche Baumgruppen wechseln sich ab mit Wiesen und Teichen. Angelegt wurde der Park bereits bis 1735, später jedoch mehrfach vergrößert. ";Seine größte Umgestaltung erfuhr er durch den preußischen Gartendirektor Peter Joseph Lenné in der Mitte des vorigen Jahrhunderts von 1852 - 1860";, lesen wir. Und da für all die künstlichen Gewässer und für die Pflanzen am Ort gar nicht so viel Wasser zu beschaffen war, wurde von 1756 an ein 28 Kilometer langer Kanal nach Südwesten zur Rögnitz gebaut, die ihrerseits vom Wasserreichen Elbetal gespeist wird. Auf Pumpwerke kann dabei verzichtet werden, denn der Kanal weist ein ausreichend großes Gefälle auf. Da das Gefälle der Sonnenstrahlen inzwischen auf einen nahenden Abend hinwies, stand anschließend der mehr oder weniger geordnete Rückzug auf dem Programm. Von ";Lulu";, wie die Stadt von den Eingeborenen auch genannt wird, sindís bis Berlin selbst auf der ziemlich geradlinigen B 5 schließlich noch fast 200 Kilometer. So steht's auf |