|
|

|
|
|

|
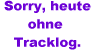
|
Wie war das noch mit dem Rabbi im Urlaub, der sich ausgerechnet am Sabbat auf den Golfplatz verkrümelt? Als er dabei einen Super-Schlag landet und sich beim Herrn für sein Glück bedankt, antwortet der amüsiert: "Wieso Glück, wenn du doch davon niemandem etwas erzählen darfst?" Nicht, dass wir auf Golf umgestiegen wären, und wir fahren ja auch sonntags, aber von manch einem Erlebnis sollte man vielleicht besser nicht berichten... Ach was, der Wasserturm war zwar nicht richtig offen, aber verschlossen eigentlich auch nicht. Es geht um den Turm bei Niederlehme (Königs Wusterhausen). Fährt man auf der Süd-Autobahn Richtung Frankfurt/Oder muss man direkt daran vorbei. Irgendwann sollte er mal zum Ausflugsziel umgebaut werden, dann sollte mal ein Planungsbüro einziehen, aber daraus ist ganz offensichtlich nichts geworden. Nun steht er da, umzäunt, wohl auch unter Denkmalschutz, auf einem verwilderten Grundstück.
Oben jedenfalls befindet sich außen eine schmale Brüstung mit vollem Blick diesmal in umgekehrter Richtung, auf die Autobahn und ins Umland. Gar nicht schlecht. Gebaut wurde der 32 Meter hohe Turm übrigens 1901 bis 1904, von einem italienischen Turmbaumeister. Auftraggeber war Robert Guthmann, ein damaliger Baustoffproduzent, der uns noch in Rüdersdorf begegnen wird. Auch die Freiwillige Feuerwehr Niederlehme durfte darin ihre Schläuche trocknen lassen, wenn diese bei einem Einsatz durchnässt worden sind. Mit Guthmann haben wir eine Überleitung zum eigentlichen Hauptthema unserer Motorradtour des vergangenen Wochenendes: Rüdersdorfs Museumspark der Baustoffindustrie. Claus-Dieter Steyer hatte unlängst auf unserer Brandenburg-Seite die aktuellen Aktivitäten des Trägervereins geschildert, aber über das Thema lassen sich ohnehin ganze Bücher schreiben. Auf dem gut 17 Hektar großen Areal verändert sich gerade jetzt sehr viel, schließlich laufen derzeit die Arbeiten im Zuge der Expo 2000 ihrem Ende entgegen. Der Museums.park ist ja wohl auch das wertvollste Schmuckstück, mit denen sich das Land Brandenburg im nächsten Jahr auf der Veranstaltung in Hannover darstellen wird.
Der Park lebt natürlich zunächst von den Bauwerken, die im Lauf seiner Geschichte entstanden sind. Und so ist es schon erstaunlich, was die 13 Mitarbeiter des Vereins an Restaurierungen angeschoben haben hier fanden sich zur Wendezeit ja praktisch nur Ruinen. Inzwischen kann man die Rumfordöfen am Eingang, und den Seilscheibenpfeiler in neuer Frische bewundern und sogar die Schachtofenbatterie innen und außen besichtigen. Außerdem sind der neue Eingangspavillon sowie das "Glashaus der Steine" so gut wie fertiggestellt. Rumford, Schachtofen, Seilscheiben? Gut, also einen Schritt zurück, im Schnellgang durch die Jahrhunderte. Kalk ist das, was uns die früheren Bewohner der Erde hinterlassen haben, Schnecken und Muscheln, zum Beispiel. Dieses Calciumcarbonat lagerte sich dicht unter der Erdoberfläche ab, konnte so also als Baustoff leicht erreicht werden. Anfangs wurden daraus nur Steine geklopft, die Klosterkirche Strausberg etwa erhielt sie schon 1254. Damals musste man das Material noch per Hand und Eisenstange herausbrechen, doch mit der Entwicklung von Sprengstoffen zu Beginn des 19. Jahrhunderts ging es schneller. "Schausprengungen" für die interessierte Bevölkerung fanden übrigens damals schon statt, in Rüdersdorf gehören sie inzwischen wieder zu den Höhepunkten von Bergfesten im Sommer.
Die ersten Kalköfen in Rüdersdorf sollen im 16. Jahrhundert errichtet worden sein. Sie hatten aber einen Nachteil: Man konnte in ihnen nicht kontinuierlich brennen, sondern nur zyklisch. Alle vier bis fünf Tage musste der Kammerofen geöffnet und entleert sowie wieder befüllt werden. Das war mit den Rumfordöfen anders. 1797 hatte Benjamin Thompson (später zum Count of Rumford ernannt) eine senkrechte Konstruktion entwickelt, bei dem die Befeuerung in etwa einem Drittel der Höhe stattfand. Oben wurde der Naturkalk eingefüllt, unten der gebrannte Kalk kontinuierlich abgezogen. Nach diesem Prinzip arbeiteten auch die 18 Öfen der Schachtofenbatterie, die bis 1877 an dem inzwischen gewachsenen Bahngelände entstanden. Die geziegelten Öfen, die die Rüdersdorfer Kapazität verachtfachten, blieben bis 1967 in Betrieb. Die Arbeit dort war hart, weil sie in großer Hitze stattfand und ebenso große Körperkraft erforderte. So mussten die Arbeiter den gebrannten Kalk aus den Öffnungen ziehen und zur Verladestation karren, ohne dass ihnen dampf- oder elektrisch betriebene Vorrichtungen dabei halfen. Die spätere Bedeutung Rüdersdorfs erwächst allerdings aus der Zementfertigung. Und das geht, grob vereinfacht, so: Nimmt man Kalkstein, vermengt ihn etwa mit Tonschiefern und anderen Stoffen, erhitzt das Ganze auf 1600 Grad Celsius (Sinterung), dann entsteht Zement, der Hauptbestandteil von Beton. Das Calciumcarbonat wird bei der Hitze zu Calciumoxid, und dieses geht eine Verbindung ein mit dem Siliciumdioxid. Das nun entstandene Calciumsilicat ist ebenfalls chemisch nicht stabil, es will Wasser einlagern. Mischt man es also mit Sand und Wasser zu einem Brei, dann wird das Wasser in die Verbindung eingelagert, sie verändert ihre Struktur, wird kristallin, "härtet aus", bindet den Zuschlagstoff Sand viel kräftiger.
Parallel dazu wurde die Forschung intensiviert, denn die gigantomane Bauwut der Nazis schrie nach formbaren Rohstoffen. 1937 entstand in Rüdersdorf ein Material, das nicht nur schnell abband, sondern dabei auch sein Volumen nur in geringem Maße verringerte. Dies wiederum ermöglichte den Beginn der Produktion von Fertigteilen, das erste ortsfeste Betonwerk Deutschlands wurde errichtet. Die Rüstungsproduktion machte nicht vor den Toren Rüdersdorfs Halt, Splitterschutzgräben wurden hergestellt, aber auch Splitterbomben, Minen und Handgranaten. Rüdersdorf war zu DDR-Zeiten nicht nur ein wichtiger Rohstofflieferant für die Neubausiedlungen der Stadt, sondern wegen seiner Staubemissionen je nach Windrichtung auch in West-Berlin gefürchtet, stand hier doch seit 1962 das größte Zementwerk der DDR. Allein 55 000 Tonnen Staub sollen auf Rüdersdorf herabgerieselt sein. Nach der Wende hat sich hier allerdings der englische Hersteller Readymix angesiedelt, der täglich rund 5000 Tonnen Zement produziert, und zwar in einem neuen Werk, das den geltenden Emissionsrichtlinien entspricht. Interessant ist hier freilich nicht nur der Überblick über die Herstellungstechniken, die über die Jahrhunderte hinweg angewandt wurden. Auch die Infrastruktur, die entstand, um das Material zu gewinnen und abzufahren, ist mehr als einen Blick wert. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Rüdersdorfer Grube war vergleichsweise noch flach wurden Kanäle errichtet. Schließlich war der Landtransport damals wegen der schlechten Straßen so gut wie unmöglich, zudem standen ja nur Fuhrwerke zur Verfügung. So hat der Spruch "Berlin ist aus dem Kahn gebaut" durchaus seine Berechtigung.
Finden wir aus all der Geschichte wieder in die Gegenwart zurück? Auch sie bietet immens viel, jedenfalls kann man sich unter www.museumspark.de ansehen, oder unter der Rufnummer 03 36 38/76 50 erfragen, was hier alles so geschieht. Schade eigentlich, dass auf dem Rückweg keine Zeit mehr blieb, um den Funkerberg in Königs Wusterhausen aufzusuchen. Dort hat der Förderverein Sender KW eine Ausstellung über die Geschichte des Rundfunks eingerichtet, die dort mit Versuchssendungen schon früh begann. Am 22. Dezember 1920 wurde bereits ein Weihnachtskonzert ausgestrahlt, lange bevor aus dem Berliner Vox-Haus das erste öffentliche Rundfunkprogramm aufgeführt wurde (29. Oktober 1923). Aber man kann ja auch für künftige Touren noch etwas in unmittelbarer Umgebung der Stadt übrig lassen. So steht's auf |