|
|

|
|
|

|
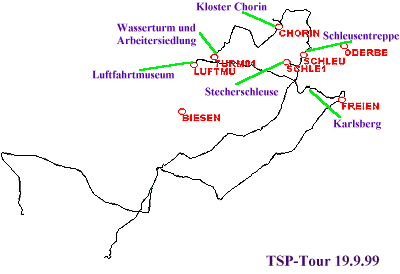
|
Türme sind einfach hervorragend. So auch der Wasserturm in Finow, Zumal man unterwegs noch auf die eine oder andere unbekannte Trouvaille stößt, wie eben auf diesen Wasserturm. Er wurde 1917 nach den Plänen des Architekten Paul Mebes errichtet und gilt als eines der frühesten Beispiele des Backsteinexpressionismus in Deutschland. 50 Meter hoch ist er, so steht es in der Stadtinformation Eberswalde, als Baumaterial diente gelbes Ziegelmauerwerk, das inzwischen leider etwas bröckelig wurde. Ein so großer Turm, gegen Ende des Ersten Weltkriegs gebaut? Nun, er diente natürlich keinen rein zivilen Zwecken, sondern als Wasserturm für das benachbarte Messingwerk und die Arbeitersiedlung daneben. Ein Förderkreis bemüht sich um die Sanierung des Turmes, berichtet uns ein Wirt, dessen Gaststätte gleich im Schatten des hohen Bauwerks liegt. Am 1. Juli nächsten Jahres wäre die Messing-Verarbeitung 300 Jahre alt geworden, das Werk freilich hat die Zeit nach der Wende nicht überlebt, hier regiert der Abrissbagger.
Nun mag das Werk geschlossen sein, aber die Siedlung steht noch - und zwar unter Denkmalschutz. Wir erblicken unter anderem einen dreigeschossigen Wohnhausblock, der teilweise zwar noch bewohnt wird, aber dennoch langsam verfällt. Schade eigentlich, denn so häufig sind solche alten Häuserzeilen aus Fachwerk nicht. Hoffentlich wird diese architektonisch interessante Hausreihe noch rechtzeitig gerettet. Messing besteht ja bekanntlich aus Kupfer und Zink - nun, und die Kupferbearbeitung geht in Eberswalde Im Dreißigjährigen Krieg wurde der Kanal zerstört, doch sollte es bis 1746 dauern, bis Ersatz vorhanden war, diesmal mit 17 Schleusen. Wer auf dem Weg von Eberswalde zum Hebewerk rechts in den Wald abbiegt, gelangt zum Beispiel zur idyllisch gelegenen Stecherschleuse - eigentlich darf man das eingezäunte Gelände nicht betreten, aber wenn man nach dem Weg fragen will, bleibt einem ja nichts anderes übrig... Derzeit diskutieren Bund und Land übrigens über die künftige Trägerschaft, denn der Kanal wird nur noch von Freizeitskippern genutzt. Weiter geht‘s, zur 13 000 Tonnen schweren Stahlkonstruktion, die 60 Meter hoch ist und Nur war damals halt noch kein Hebewerk vorhanden. Also musste man die Schiffe durch vier aufeinander folgende Schleusen bugsieren - was ewig dauerte und viel Wasser verbrauchte (obschon auch damals schon Wassersparbecken seitlich installiert waren). Diese Anlagen sind heute noch zu sehen, sie sind technisch eigentlich fast noch interessanter als der riesige Aufzug für Binnenschiffe nebenan. Weiter geht‘s Richtung Liepe, und dann nach links weg Richtung Brodowin. Die Straße stammt aus der Zeit vor der Erfindung des Verkehrswegebaus, der Kopfsteinpfad ist an manchen Stellen dermaßen gewölbt, dass er für herkömmliche Autos praktisch unpassierbar ist (obschon es immer wieder probiert wird). Aber mit den Moppeds geht es gut, vor allem, weil hier die tiefergelegten Humpftamobile nicht durchkommen, jene rollenden Subwoofer, die sonst die Landstraßen mit dem rhythmischen Gedröhn belegen, Nun steht das Kloster Chorin auf dem Programm, besser: das, was davon noch übrig blieb. Schließlich wurde es bekanntlich schon 1258 als Ableger der Zisterzienser-Niederlassung in Lehnin gegründet. Im 16. Jahrhundert verfiel die Anlage, wurde sogar als Steinbruch genutzt und erst auf Veranlassung von Friedrich Wilhelm IV. um 1830 gerettet. Berlins bekanntester Architekt Karl Friedrich Schinkel und der ebenso berühmte Landschaftsplaner Peter Joseph Lenné taten sich hier nützlich. Und bis in heutige Zeit hinein wird immer wieder an dem Ensemble gearbeitet, gilt es doch als bedeutendstes mittelalterliches Kloster in Brandenburg. So viel Kultur legt den Magen in Hungerfalten - also ein paar Meter zurück und hinein nach Chorin. Beim Landgasthaus zur Kroneneiche hatten wir schon telefonisch vorbestellt (0333 66/280), also geht‘s schnell an den lecker gefüllten Napf. Allein schon die Bratkartoffeln sind ein Gedicht in Mampf und Schleck, in unserem Restoführer durchs Umland gibt‘s dafür vier Helme und zwei Fliegen als Auszeichnung. Die Stärkung war nicht verkehrt, denn anschließend sollte die Stollenreifenfraktion auch einmal zu ihrem Recht kommen. Auf legalen Ackerwegen ging‘s über Britz und Lichterfelde nach Finow, wo der Turm stach (ins Auge, siehe oben). Wem das zu viel war, der konnte herkömmliche Straßen außen herum benutzen. Was wäre aber ein solcher Ausflug ohne Flugzeuge? Über Finowfurt erreichen wir eine Ecke des früheren Militärflughafens Finow. Wer die Tour nachfahren möchte, dem sei die Anreise über Bernau empfohlen. Im Nordosten der Stadt zweigt die Strecke nach Albertshof und Tempelfelde ab, Gratze, Beerbaum und Heckelberg folgen sowie Kruge, Gersdorf und Hohen- und Niederfinow. Sieht man einmal von modernen Windkraftanlagen ab, sprühen Landschaft und Dörfer bisweilen geradezu noch vor ostalgischem Charme - nur der "Duft" nach Braunkohle und Desinfektionsmittel fehlt. Mit dem inzwischen eingetretenen Witterungswechsel riecht’s dafür in den Waldstücken schon anders als im Sommer. Laub und morgendliche Luftfeuchtigkeit werden insbesondere auf Kopfsteinpflaster zu jenen Wegbegleitern, die eine eher kontemplative Fahrweise provozieren. Aber selbst auf diesen sonst recht leeren Nebenstraßen ist Zurückhaltung am Drehgriff ja kein Fehler, da haben die Augen umso häufiger Gelegenheit, sich auf die Gebäude am Streckenrand zu konzentrieren. Es müssen ja nicht gleich riesige Türme sein. So steht's auf
Zwischen Eberswalde und Bad Freienwalde, kurz hinter Falkenberg, geht rechts ein Weg rauf zum Karlsberg. Oben stand einmal eine Burg, auf den Grundmauern steht jetzt ein Restaurant, in dem allerlei Plüsch und Kitsch verkauft wird, von dem man aber mit riesigem Blick über das Oderbruch wunderbar die Abendstimmung genießen kann. Über die 158 ist man auch im Dunkeln schnell zurück in Berlin. -Peter G 
|